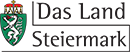Unkonventionelle Forschung (UFO) 2025
Am 03. Juli 2025 wurden von der Steiermärkischen Landesregierung 13 Projekte der Ausschreibung „Unkonventionelle Forschung 2025" mit einer Höhe von EUR 1.299.971,00 zur Förderung beschlossen.
Ergebnis der Ausschreibung - geförderte Projekte
Geförderte Projekte
GMB-Stim (PN 4002)
Gezielte elektrische Feldstimulation als neue Therapiemethode für Glioblastom Tumore
Projektpartner: Medizinische Universität Graz, Gottfried Schatz Forschungszentrum, Lehrstuhl für Medizinische Physik und Biophysik
Projektleitung: Dr.in Marta Nowakowska-Desplantes, PhD
Das Glioblastom ist ein besonders aggressiver Hirntumor. Neueste Erkenntnisse zeigen, dass rhythmische Kalziumsignale zwischen Tumorzellen sein Wachstum fördern. In diesem Projekt wird erforscht, ob elektrische Feldstimulation diese Signale gezielt stören kann, um das Tumorwachstum zu bremsen. Mithilfe moderner Zell- und Gewebeanalysen soll eine neue, minimalinvasive Behandlungsstrategie entwickelt werden. Graz könnte damit eine Vorreiterrolle in der neuroonkologischen Forschung und bioelektronischen Medizin einnehmen.
Multi-Omics für personalisierte Onkologie (PN 4005)
Multi-Omics für personalisierte Onkologie im molekularen Tumorboard
Projektpartner: Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Onkologie
Projektleitung: Samantha Hasenleithner, PhD
Krebserkrankungen sind genetisch bedingt und verlangen präzise Therapien. Konventionelle Tests erfassen nur einen Teil der molekularen Vorgänge. Ein Multi-Omics-Ansatz integriert Genom-, Transkriptom- und Epigenetik für ein umfassenderes Verständnis. In Graz werden vier neue Testverfahren, darunter Ganzgenomsequenzierung und hochauflösende WGS von cfDNA, in einer Machbarkeitsstudie geprüft, um ihren Einsatz in der klinischen Routine zu evaluieren. Diese retrospektive Analyse soll zusätzliche Angriffspunkte für personalisierte Therapien bieten und Resistenzen frühzeitig erkennen.
PERMANENCE (PN 4011)
Seltene-Erden-freie MnBi Permanentmagnete durch Korngrenzendesign
Projektpartner: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Projektleitung: Dr. Anand Krishnakurup Sreekumaran Nair
Permanentmagnete, die Seltene Erden (SE) enthalten, finden in vielen Bereichen Anwendung, zum Beispiel in verschiedenen alltäglichen Geräten, Elektrofahrzeugen bis hin zu industriellen Anwendungen. Angesichts des wachsenden Marktes für Permanentmagnete ist es wichtig, eine Alternative ohne SE zu entwickeln, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. MnBi-basierte Magnete sind eine solche potenzielle Alternative. Das Hauptziel dieses Projekts ist die Verbesserung der magnetischen Eigenschaften von MnBi-basierten Magneten durch Korngrenzendesign.
NanoMet (PN 4033)
Nanokristallisation durch Wasserstoff-Legieren in hochverformten Metallen
Projektpartner: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Erich-Schmid-Institut für Materialwissenschaft
Projektleitung: Dr.in Marlene Kapp
Die Entwicklung zukunftsfähiger Materialkonzepte muss auf Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit von kritischen Rohstoffen ausgerichtet sein. Temporäres Legieren auf Basis von Wasserstoff ist ein innovatives Verfahren zur Synthese hochfester und zugleich vollständig wiederverwertbarer Materialien ohne Legierungselemente. Die Kombination aus temporärem Wasserstoffzusatz während der Hochverformung generiert Nanostrukturen mit immenser Festigkeit in Reinmetallen. NanoMet soll dafür die bislang unberechenbare Interaktion von Wasserstoff mit deren Strukturbauteilen in kontrollierbare Bahnen leiten.
Wissenschaftsfreiheit als Funktionsbedingung der liberalen Demokratie (PN 4034)
Wissenschaftsfreiheit als Funktionsbedingung der liberalen Demokratie: Effektuierung einer altbekannten Garantie im Licht neuartiger Herausforderungen
Projektpartner: Universität Graz, Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft
Projektleitung: Dr.in Elisabeth Paar, LL.M. (Yale)
Mit zunehmender Gefährdung der Wissenschaft in zahlreichen Forschungshochburgen, insbesondere den USA, kann die Gewährleistung eines hohen Niveaus an Wissenschaftsfreiheit einen entscheidenden Standortvorteil darstellen. Der gegenwärtige verfassungsrechtliche Rahmen in Österreich begünstigt dies jedoch nur bedingt. Das vorliegende Forschungsvorhaben strebt eine grundlegende Evaluierung der Wissenschaftsfreiheit an. Dies im Licht des Bestrebens, herausragende Forscherinnen und Forscher nicht nur anzuziehen, sondern auch zu halten.
faserSTOFFWECHSEL (PN 4039)
Entwicklung neuer Materialpfade für Textilabfälle
Projektpartner: Technische Universität Graz, Institut für Biobasierte Produkte und Papiertechnik
Projektleitung: Dipl.-Ing. Dr. Thomas Harter, BSc
faserSTOFFWECHSEL verfolgt einen neuartigen Zugang zur textilen Kreislaufschließung und widmet sich einer Herausforderung, die angesichts wachsender Textilmengen drängender denn je ist: der stofflichen Verwertung von Post-Consumer-Textilien niedriger Qualität. Durch gezielte, schonende Aufbereitung soll gezeigt werden, wie sich selbst schwer recycelbare Alttextilien in langlebige, kreislauffähige Materialien überführen lassen. Das Projekt erschließt ein bisher vernachlässigtes Ressourcenfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und technologischem Zukunftspotenzial.
Gas-zu-Methanol (PN 4042)
Nachhaltige Methanolproduktion durch elektrochemische Direktoxidation von Methan
Projektpartner: Technische Universität Graz, Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik
Projektleitung: Dr.in Michaela Roschger
Methanol ist ein wichtiger Grundstoff der Industrie und könnte auch als klimafreundlicher Treibstoff dienen. Herkömmliche Herstellungsverfahren sind jedoch teuer und energieintensiv. Dieses Projekt erforscht die direkte elektrochemische Umwandlung von Methan zu Methanol bei Umgebungsdruck und -temperatur. So lässt sich nachhaltig Methan nutzen und das klimaschädliche Abfackeln von Erdgas durch die Verflüssigung vermeiden: ein Beitrag zu nachhaltiger Chemie und Energiewende.
H2-Stress-Protect (PN 4043)
Unsichtbare Schutzschilde: Druckspannungen gegen Wasserstoffversprödung
Projektpartner: Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für funktionale Werkstoffe und Werkstoffsysteme
Projektleitung: Dipl.-Ing.in Dr.in Anna Sophie Jelinek
Wasserstoff gilt als Schlüsselenergieträger der Energiewende, doch Wasserstoffversprödung gefährdet die Lebensdauer metallischer Werkstoffe. Unser Projekt erforscht daher die unkonventionelle Möglichkeit von Druckspannungen als „unsichtbare Schutzschilde". Durch Kugelstrahlen und in keramischen Hartstoffbeschichtungen sollen diese gezielt eingebracht werden, um Wasserstoffdiffusion zu hemmen und die Rissbildung unter zyklischer Belastung zu verzögern. An einem ferritischem Modellstahl wird ihr Einfluss auf die Ermüdungsbeständigkeit unter Wasserstoff erstmals systematisch untersucht mit dem Ziel, eine revolutionäre Basis für langlebige Werkstoffe in künftigen H₂-Technologien zu schaffen.
Arsen als biologisches Redoxelement (PN 4044)
Arsen als essentielles Element? Multiomische Untersuchung der schützenden Rolle von Arsen gegen UV-induzierten oxidativen Stress in Meeresalgen
Projektpartner: Universität Graz, Institut für Chemie
Projektleitung: Dr.in Viktoria Müller
Arsen gilt meist als toxisch, doch könnte es in Meeresalgen eine schützende Rolle gegen UV-induzierten oxidativen Stress spielen. Algen, besoderes in tidalen Habitaten, sind intensiver UV-Strahlung ausgesetzt, wodurch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) entstehen. Unsere Hypothese besagt, dass Arsen in Algen ein Redoxsystem (AsIII/AsV) bildet, das ROS neutralisieren und Lipidperoxidation, sowie Proteinphotooxidation verhindern könnte. Das Projekt testet diese Idee experimentell und könnte eine neue, biologische Funktion von Arsen aufzeigen.
CellBreak (PN 4046)
Biotechnologische Erweiterung von Komagataella phaffii zur oxidativen Erschließung kristalliner Zellulose
Projektpartner: Technische Universität Graz, Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBT)
Projektleitung: Dipl.-Ing. Lukas Rieder, PhD
„Hefe frisst Holz" - unter diesem Leitmotiv soll Komagataella phaffii in CellBreak dazu befähigt werden, Zellulose als nicht-nahrungsmittelbasierte Kohlenstoffquelle zu nutzen. Ziel ist der Aufbau einer nachhaltigen biotechnologischen Plattform. Durch gezielte Ergänzung fehlender oxidativer Enzyme, wird kristalline Zellulose effizient aufgeschlossen. Der resultierende Plattformstamm eignet sich für Enzymproduktion, Ganzzellbiokatalyse, die Entwicklung holzbasierter Produkte, von Feinchemikalien bis hin zu Pharmazeutika, und um die Komplexität des Zelluloseabbaus besser zu verstehen.
TAHIS (PN 4059)
TAHIS - Tomografische Analyse von Hochspannungs-Isoliersystemen
Projektpartner: Technische Universität Graz, Institut für Hochspannungstechnik und Systemmanagement
Projektleitung: Ass.-Prof. Dr. Oliver Pischler
In Hochspannungsisolierungen, etwa in Energiekabeln, können sich im Betrieb Ladungsträger ansammeln, die das Material schädigen und im schlimmsten Fall Black-outs verursachen - ein ernstes Risiko für die Versorgungssicherheit und den dringend nötigen Netzausbau. Bestehende Messverfahren stoßen dabei oft an ihre Grenzen, insbesondere bei komplexen Komponenten wie Kabelmuffen. In diesem Projekt werden tomografische Methoden genutzt, wie sie auch in anderen Bereichen von Wissenschaft und Technik zum Einsatz kommen, um solche schädlichen Ladungen präzise erfassen und bewerten zu können.
Hydrogel-basierte Nervenconduits kombiniert mit Eigenfett als Therapieoption bei peripheren Nervenläsionen (PN 4060)
Anwendung von Eigenfett in Kombination mit Hydrogel-basierten Nervenconduits zur Förderung der Nervenregeneration nach Verletzung peripherer Nerven
Projektpartner: Medizinische Universität Graz, Abteilung für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, LKH Univ. Klinikum Graz
Projektleitung: Priv.-Doz. DDr. Raimund Winter
Ziel des Projekt ist, ein Nervenconduit mit Hydrogel zufüllen und zusätzlich innen mit Stammzellen angereichertes Eigenfett einzubringen. Das artifizielle Röhrchen soll als Defektüberbrückung dienen und richtungsweisend für die aussprossenden Axone der beschädigten Nervenenden sein. Das Hydrogel dient als innere Füllsubstanz und Stabilisator für das Conduit. Die bis dato kaum erforschte Kombination mit Eigenfett soll durch die heilungsfördernden Fähigkeiten der enthaltenen Fettzellen zu einer deutlichen Verbesserung der Nervenregeneration führen. Die Methode wird in einem 9-monatigen Tiermodell erprobt.
Wiederlesbarmachung steirischer Römersteine mithilfe optischer Messtechniken (PN 4067)
Wiederlesbarmachung steirischer Römersteine mithilfe optischer Messtechniken
Projektpartner: Universität Graz, Institut für Antike
Projektleitung: Dr. Gregor Diez
Zu den größten Herausforderungen der althistorischen Forschung, insbesondere der Epigraphik (Inschriftenkunde), gehört es, verwitterte oder zerstörte antike Inschriften wieder lesbar zu machen. Eine Kombination optischer Messtechniken, insbesondere der Multispektralanalyse und der aktiven Thermografie, bei der Objekte gezielt erhitzt und der Abkühlungsprozess beobachtet wird, könnte nicht lesbare Inschriften rekonstruieren. Die erfolgreiche Anwendung dieser unkonventionellen Methoden wäre ein erheblicher Durchbruch in der Geschichtsforschung und würde historische Inschriften für neue Lesearten und Interpretationen öffnen.
Ausschreibung
Das Land Steiermark ermöglicht mit dem Förderungsinstrument UFO qualifizierten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern die selbständige und eigenverantwortliche Forschung an neuen und unkonventionellen wissenschaftlichen Ansätzen, Methoden, Theorien, Standards und Ideen. Wir fördern vielversprechende und originelle Forschungsvorhaben, ...
- die neue, innovative Wege beschreiten und dafür unkonventionelle Zugänge wagen
- die an Schnittstellen von Themen und Disziplinen neue Fragestellungen entwickeln oder neue Perspektiven einnehmen
- die sich auf keine oder wenige vorhandene Daten stützen und innerhalb kurzer Zeit umgehend entwickelt oder getestet werden können
- die Fragen von hoher wissenschaftlicher, technologischer oder gesellschaftlicher Relevanz aufgreifen und eine Basis für weiterführende Forschungsprojekte schaffen
- mit denen junge Forscherinnen und Forscher mutige Ideen umsetzen, Risiken eingehen und bisherige Pfadabhängigkeiten verlassen können
- die das Potential für neue außergewöhnliche wissenschaftliche Leistungen besitzen.
Es ist explizit erwünscht, aber kein Muss, dass die Forschenden dabei auch Risiken eingehen und bisherige Pfadabhängigkeiten verlassen. Das Programm UFO hat einen primären Fokus auf die Förderung von Forschungsvorhaben im Bereich der Grundlagenforschung. Es sind nur Projekte im nicht-wirtschaftlichen Bereich förderfähig.
UFO richtet sich an alle an steirischen Hochschulen und steirischen außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Forscherinnen und Forscher in der PostDoc-Phase in den ersten 5 Jahren nach der Promotion (Karenz- und Mutterschutzzeiten werden nicht eingerechnet). Mit der Förderung im Rahmen von UFO soll die wissenschaftliche Karriere der Projektleiterin / des Projektleiters einen nachhaltigen Impuls erhalten und Fortschritte in der wissenschaftlichen Entwicklung ermöglichen oder zumindest die Grundlage für potentielle Fortschritte aufbauen.
Einreichzeitraum/Antragstellung
Anträge konnten bis zum 28. April 2025, 12:00 Uhr (Mittag), an die Abteilung 12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung (Referat Wissenschaft und Forschung) übermittelt werden.
Für Einreichungen im Rahmen dieser Ausschreibung war unbedingt folgendes Antragsformular zu verwenden:
 Antragsformular [doc]
Antragsformular [doc]
Verspätet eingereichte Anträge konnten nicht berücksichtigt werden!
Dotierung/Budget
Für diese Ausschreibung werden Fördermittel iHv € 1.300.000,00 zur Verfügung gestellt, pro Projekt kann eine Förderung in Höhe von € 50.000,00 bis maximal € 110.000,00 erzielt werden.
Downloads
 Ausschreibung [pdf]
Ausschreibung [pdf]
 Antragsformular [doc]
Antragsformular [doc]
Finanzplan und Abrechnungsformular [html → xlsx]
Endbericht/Merkblatt [html → doc]
Richtlinie zur Förderung von Wissenschaft und Forschung [html → pdf]
Kontakt
Mag. Manuel P. NEUBAUER
manuel.neubauer@stmk.gv.at
+ 43 0316 877 3146
Mag. Dr. Andrea STAMPFL-PUTZ
andrea.stampfl-putz@stmk.gv.at
+ 43 0316 877 2915
Mag. Marina TRÜCHER
marina.truecher@stmk.gv.at
+ 43 0316 877 2295